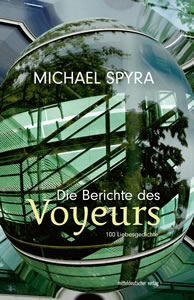Lepcha lernen
Lepcha ist eine von ca. 7000 Sprachen, die momentan auf der Erde gesprochen werden. Noch, muss man sagen, denn ernst zu nehmende Schätzungen gehen davon aus, dass zum Ende dieses Jahrhunderts mehr als die Hälfte ausgestorben sein wird.
Auch Lepcha, das in Teilen Indiens (Sikkim, Darjeeling), Nepals und Bhutans gesprochen wird, ist eine gefährdete Sprache. In Gangtok befindet sich das Sikkim’s Endangered Language Documentation Project (SELDP) an der School of Languages and Literature, Sikkim University. Von dort kam mit der großzügigen Unterstützung von Nim Tshering Lepcha (Übersetzer), Pabitra Chettri (Technische Assistentin, SELDP) und Samar Sinha (Leiter, SELDP) ein Satz in Lepcha zu mir.
Er lautet: sonapre kursuksa miŋtʰjuŋ ɡum
Es ist eine Transkription, auf eine Fassung in Lepcha-Skript hoffe ich noch. Ich bin kein Linguist, also warum interessiert mich das?
Seit vier Jahren jage ich für ein Projekt der Künstlerin Vera Röhm mit Tausenden von Emailanfragen den entlegensten Sprachen unseres Planeten hinterher.
Dabei trete ich in Kontakt mit Professor*innen, die seit Jahrzehnten an einer Sprache forschen, aber auch Student*innen, die noch ganz am Anfang ihres Studiums sind und doch vielleicht bald die einzigen Expert*innen für die jeweilige Sprache sein werden.
Was motiviert Menschen, fremde, gefährdete Sprachen zu studieren?
Für Paul, eine der beiden deutschen Protagonisten der Reiseerzählung Zeit zieht nicht von Wolfgang Allinger und Ute Kliewer ist die Frage leicht zu beantworten.
„Wolfgang Allinger | Ute Kliewer: „Zeit zieht nicht. Erzähl mir von Darjeeling““ weiterlesen