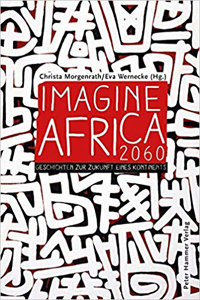Das Leuchten der Ränder
Man kann sich nicht lange der Illusion hingeben, das Leuchten an den Rändern unserer Welt, das stets auch bedeutet: an den Rändern unserer Sprache(n), unseres verbalen Ausdrucksvermögens, sei ein Licht am Ende einer anhaltenden Dunkelheit. Was uns Leopold Federmair, mittlerweile seit 17 Jahren in Japan lebend, in seinem neuen Roman vorführt, ist eine Erstarrung, ein Verlöschen, ein Scheitern – und ein Trotzdem. Mit Die lange Nacht der Illusion schließt der Österreicher nach Tokyo Fragmente (2018) und Schönheit und Schmerz (2019) seine Japan-Trilogie ab.
Es geht um ein aufgebrochenes Dreieck zwischen Mutter, Vater und Tochter. Oder nein, besser: um die der Stabilität der Familie verlustig gewordenen Hauptpersonen Yuuki, Theo und Yoko.
Sie hatte ihren Mann nie „Vater“ genannt, wie es so viele japanische Ehefrauen taten, sobald ein Kind da war (auch in Geschäften, auf Ämtern, im Krankenhaus wurde man so angesprochen). Die Einzelperson war identisch mit der Rolle, die sie spielte.
Dies sind Sätze mit universellem Inhalt. Sie belegen, dass Ränder überall sind. Findet diese Nichttrennung von Person und Rolle nicht auch flächendeckend in Europa und sonst auf der Welt statt? Und führt dieses Verschleifen nicht früher oder später zu einem Identitätsverlust? Das sind Fragen, die in der Familie bleiben dürfen, um dort ihre Antwort zu finden.
Ja, man kann sagen, Federmairs Roman ist eine „kleine Japan-Kunde“, wie es Sebastian Fasthuber formuliert hat, aber er geht noch sehr viel tiefer in den Bereich zwischenmenschlicher Nicht-Kommunikation, die per se immer nur an den Rändern geschieht. Wir alle leben auf einer schmalen Kruste Zivilisation und vergessen, wie sehr es im Innern (unseres Planeten) brodelt. Und schaffen dann doch (trotzdem!) eine kühne und kühle Analyse, die Worte setzt, wo Leerstellen sich eingenistet haben.
Die Beziehung zwischen uns, Yuuki und mir, ist mit der Zeit immer feiner geworden, ein jedesmal zerbrechlicheres, reineres Gespinst aus Zeit. Und dann wieder gröber, mag sein, es gab Brüche und Abbrüche, so wie jetzt, plötzlich, ohne Übergang, keine Brücke, nicht einmal eine Furt.
Yuuki trennt sich von Theo, als Yoko in der sechsten Klasse ist. Sie verlässt Tokio und die Familie. Theo erinnert sich:
Plötzlich, ohne Vorankündigung, während der Ferien. Ein Kollege in der Zweigstelle ihrer Firma in Nagasaki, kaum älter als sie, zuständig für International Consulting, war einem Herzinfarkt erlegen, angeblich konnte nur Yukki ihn so kurzfristig ersetzen. Für sechs Monate, hatte es geheißen, bis ein Ortsansässiger eingeschult wäre, aber bald war von einem Jahr die Rede gewesen.
Federmair baut den Roman in zwei Teilen (Okarina und Kinkakuji) auf und ergänzt eine Einleitung (Affektenlehre) und einen kurzen Schlusstext (Kein Traum). Er macht sich Gedanken über das Erzählen und sucht nach neuen Formen der Romanstruktur. Als Instanz Autor wird Federmair erkennbar, wenn er schreibt:
Kaum eine Erzählung echter („echter“) Ereignisse läßt sich mit exakt der selben Anzahl von Worten bewältigen, die eine andere beansprucht; nicht einmal zwei Versionen ein und desselben Ereignisses sind in der Regel gleich lang, ganz zu schweigen von unterschiedlichen Rhythmen, Pausen, Akzentuierungen. Mehr noch, es fragt sich, ob zwei Ereignisse überhaupt gleichzeitig geschehen können. […] Blieb immer noch die Frage, wer beginnen würde, wie bei einem Gesellschaftsspiel, etwa: Der Jüngste zuerst. Oder nach der alten Regel des Gentlemans: Ladies first! Ich oder du, im Grunde genommen ist es egal.
Zunächst folgen wir Yuuki nach Nagasaki. Das Kapitel Okarina baut eine durch Einsamkeit und Entfremdung bedrohliche Kulisse auf, die sich in einer Extremwetterlage mit Starkregen, Überflutungen und schließlich einem Erdrutsch Bahn bricht und dabei alles, was an Ordnung und Sicherheit gültig war (hierfür die Metapher des violetten Müllsacks, dessen Inhalt nicht fachgerecht entsorgt wird), mit sich reißt.
Unschwer, sich dieses Katastrophenszenario vorzustellen, haben wir doch noch die Bilder des Tsunamis vom 11. März 2011 in unseren europäischen Köpfen. Doch wer in Japan lebt, braucht nicht so weit zurückgreifen, Murenabgänge und Hochwasser kommen immer wieder (öfter?) vor. Federmair dürfte hier den Bergrutsch vom Juli 2018 verarbeitet haben, als im Westen Japans und seinem Wohnort Hiroshima über hundert Menschen starben. Oder aber jenen vom August 2014 mit Dutzenden Toten.
Sturzbäche suchten sich Wege, Bette entstanden im Nu, Seitenarme flohen in den unversehrten Wald, vereinzelt kollerten Steine, schwarze Schollen rührten sich dumpf wie Rücken gewaltiger Schlangen. Die Mulde vor der Straße, am Fuß der Böschung, war jetzt, im lidlosen Traum, ein See. Und dann, im nächsten, wie letzten Augenblick, lag alles still, das Grollen war verklungen, nur das viel leisere, fast schon zarte Rauschen des Regens erfüllte den für immer – Jahrzehnte oder Jahrhunderte – veränderten Raum: die Traumlandschaft einer Mure […]
In der Szene, als Yuuki im obersten Stockwerk des Hochhauses der Künstlerin begegnet, die nachts die Okarina spielt, liegt ein besonderer Zauber mit ebenso viel Irritation wie Hoffnung. Yuuki, die Einzelgängerin, begegnet Menschen, Individuen, die nicht in der Uniformität der japanischen Gesellschaft aufgehen. Da passt jemand nicht ins System – und das ist gut so! Das nächtliche Okarinaspiel ist eine gelungene Interpretation einer Szene aus dem Animefilm Mein Freund Totoro, in der Totoro auf der Baumkrone thront, die Okarina spielt und eine kindlich-naive Hoffnung schenkt: Trotz alledem, alles wird gut!
Kurz nach der Katastrophe telefonieren Yuuki und Theo. Ist die Entfernung, die Entfremdung groß, so sind doch beide froh, einander zu hören, das wohl bekannte Schweigen des anderen zu hören, ein Lebenszeichen, wertvoll im Angesichts des Todes: ein Leuchten der Ränder!
Theos Perspektive, die im Kapitel Kinkakuji ausgebreitet wird, ist mit Yuukis nicht deckungsgleich. Kann es nicht sein. Der verlassene Ehemann, der sich um seine inzwischen in der Pubertät befindlichen Tochter kümmert, er hätte sich Raum nehmen können für eine lange Klage, ein Lamento auf die Ungerechtigkeit der Welt. Er tut es nicht. Er nimmt sich zurück. Der Fokus ist auf der Gegenwart, in der Theo sich seines viel tiefer gehenden Scheiterns am Leben, das sich in den kleinen Dingen zeigt, gewahr wird. Zum Beispiel am Erlernen der Schriftzeichen:
So viele Zeichen mußten draußenbleiben, sie schafften den Eintritt nicht, gewannen kein Bleiberecht. Bei seiner Tochter hingegen, das bemerkte er nicht nur im Hinblick auf die Landessprache, sondern auch beim Erkennen und Behalten von Details auf Bildern und in Filmen oder beim Anhören und Bewahren von Melodien und Liedtexten, genügte ein ein- oder zweimaliges Hören, Sehen oder Schreiben, damit sie, wahrscheinlich für alle Zeiten, ins Gedächtnis Aufnahme fanden.
Mit dem Wort Bleiberecht ruft Federmair eine Diskussion um Migration auf. Ist es nicht eine legitime Forderung, dass die, die zu uns kommen und bleiben wollen, unsere Sprache erlernen, sich an unsere Regeln halten? Der wachsame Nachbar hat einen Hinweis an den violetten Müllsack angebracht, nach ein paar Tagen wird der Bemerkung mehrsprachig, vielleicht, nein: bestimmt ist der Malefikant ein Ausländer!
Was passiert jedoch, wenn trotz guten Willens nicht gelingt, in Sprache und Kultur tief genug einzutauchen?
Sein Wunsch, diese Sprache zu erlernen, und nicht nur die gesprochene Sprache, sondern auch die Schrift, mit der sie festgehalten wird, dieser Wunsch war erwacht, als er den bekanntesten der Romane Yukio Mishimas in einer alten, längst vergriffenen deutschen Übersetzung las. Oder genauer, als er das Buch mit der holperigen Übersetzung und dem Fünfzigerjahre-Cover, das den Schattenriß eines Tempels mit Rot und Gelb drumherum zeigte, weglegte, weil er es nicht mehr länger ertrug, die Eleganz von Mishimas Sätzen, die er zu ahnen glaubte, mit solch groben deutschen Füßen getreten zu sehen.
Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Ein Yoko mitgegebenes Informationsschreiben der Schule kann Theo nicht lesen, deren Zeichen nicht entziffern, nicht richtig deuten. Die Tochter muss ihm den Text vorlesen. Hier zeigt sich, was es heißt, müde vom Leben zu sein: Ein Prozess des Welkens, während die Tochter aufblüht und ihre Kraft, ihre Duftmarken verströmt. Manchmal sagt sie ihrem Vater, er sei dumm. Halb, um ihn zu necken, halb, um ihn zu verletzen, in einem Ablösungsprozess, in dem Väter alt werden.
An irgendeinem Punkt, der ihm entgangen war und den er auch im Rückblick nicht genau zu bestimmen vermochte, hatte sich alles geändert. Die Geschichte – seine Geschichte – war gekippt. Einmal, als er seiner in Zorn geratenen Tochter schweigend zuhörte, sah er dieses Kippen deutlich vor sich: ein Bunker im Sand der Atlantikküste. Der Betonklotz verwandelte sich, während die zornige Stimme lauter wurde, in ein riesiges, viel zu großes, behäbiges Tier, das langsam zur Seite fiel und dann schicksalsergeben im Staub lag, es würde sich nie mehr erheben.
Federmair findet Worte für Prozesse innerhalb der Familie, die uns allzu oft verletzt zurücklassen, kraftlos, ratlos. Dass er seiner Figur Theo nahe ist und dabei eine Sprachkraft entwickelt, die Distanz schafft, Selbstbeobachtung ohne Anflug von Larmoyanz ermöglicht, die Leere in unaufgeregter und präziser Weise füllt, das ist Sprachkunst.
Übersetzen kann man nur trotzdem. Trotz was? („Wotrotz“?) Leben kann man nur trotzdem. […] Worte machen inmitten einer Unzahl von Wörtern. Indem er bis zum letzten Atemzug seine wachsende Tumbheit bekämpfte, bekämpfte und umhegte, würde der Roman vom Goldenen Tempel aus den verbrannten Wörtern noch einmal, das erste Mal, entstehen.
Am Ende erweist sich das Leuchten doch als reines Licht einer hinter sich gelassenen Dunkelheit.